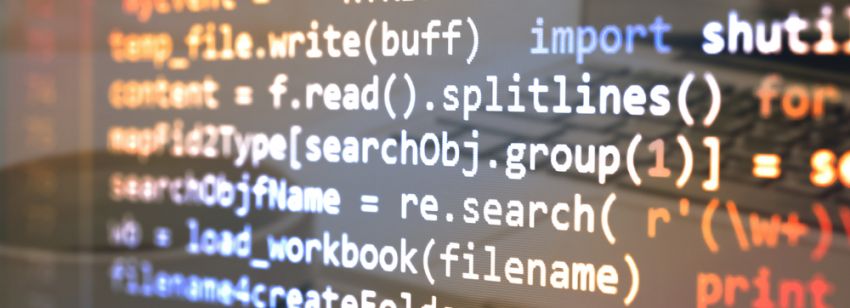Künstliche Intelligenz erobert die Medizin – wie Algorithmen die Palliativversorgung revolutionieren könnten
Über den Autor

Dipl.-Kauffrau Heike Kielhorn-Schönermark
Gründerin und Geschäftsführerin
Gründerin und Geschäftsführerin
Fon: +49 511 64 68 14 – 0
Fax: +49 511 64 68 14 – 18
Fax: +49 511 64 68 14 – 18
- Ärzte ziehen Patienten oftmals erst gar nicht für eine Palliativversorgung in Betracht. Dies kann mehrere Gründe haben: zu viel Optimismus, Zeitdruck oder Behandlungsträgheit, das heißt die Tendenz in etablierten Behandlungsroutinen zu verharren.
- Die meist noch „manuelle“ Identifikation von potentiellen Palliativkandidaten und der große Mangel an professionellen Palliativmedizinern und -pflegekräften macht eine proaktive Klassifizierung teuer und zeitaufwendig. Hinzu kommt, dass es schwierig ist, Kriterien zu definieren, mit denen zuverlässig Patienten identifiziert werden können, die von palliativer Versorgung profitieren.
Das Stanfordteam hat einen Algorithmus entwickelt, der auf Basis der Berechnung der Sterbewahrscheinlichkeit eines Patienten in den nächsten zwölf Monaten, Handlungs- bzw. Überweisungsempfehlungen in die Palliativversorgung ausspricht. Das maschinelle Lernen („Deep Learning“) befreit Palliativteams von langwierigen, manuellen Zuweisungsanalysen, verhindert potentielle Verzerrungen durch menschliche Beurteilungen und ermöglicht so objektive Handlungsempfehlungen auf Grundlage von digitalen Patientendaten (Electronic Health Record (EHR) data). Beim maschinellen Lernen werden mithilfe eines Algorithmus riesige Datenmenge analysiert und gemeinsame Merkmale, zum Beispiel Muster und Gesetzmäßigkeiten, identifiziert. Der „Lerneffekt“ besteht darin, dass das System daraufhin unbekannte Datensätze von ähnlicher Art analysieren und bewerten kann. Das aus dieser Datenanalyse resultierende Modell von Avati et al. wird momentan in einem Pilotprojekt getestet und auf Basis der sich kontinuierlich erweiternden Datenlage bzw. Lernerfahrung adjustiert.
Längst sind es nicht mehr nur Facebook, Google, Zalando & Co., die mithilfe von künstlicher Intelligenz bzw. maschinellem Lernen ihre Sprachdialoge in Kundendienstsystemen, Online-Kaufempfehlungen oder Werbung optimieren. Künstliche Intelligenz ist aus dem Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken, was neben den Ergebnissen von Anand Avati nicht zuletzt auch der jüngst eingerichtete Marktplatz (ähnlich einem App-Store) für diagnostische Bildgebung unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz zeigt.
Als etablierte Strategieberatung im Gesundheitswesen verfolgt die SKC Beratungsgesellschaft die digitale Transformation der Gesundheitsbranche mit großem Interesse und entwickelt für ihre Klienten Konzepte zur Ausschöpfung digitaler Potentiale aus einer gesamtstrategischen Perspektive.
VON Dipl.-Kauffrau Heike Kielhorn-Schönermark, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin, SKC Beratungsgesellschaft mbH und Beate Kasper, M.A. Soziologie, SKC Beratungsgesellschaft mbH
Quellen:
Avati et al.: "Improving Palliative Care with Deep Learning"